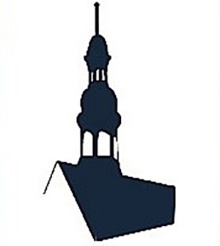1766 schrieb Johann Philipp Stumm in einem Brief, er habe gerade die sechste von seiner Firma erbaute Orgel in Trier aufgestellt. Vier von ihnen können wir zuordnen: Die Orgel des Agnetenklosters 1729, die vor 1754 gebaute Chororgel im Dom, die Welschnonnenorgel 1757 und das Instrument des Johannisspitälchens 1763. Aus dem neunzehnten Jahrhundert kennen wir noch zwei weitere Trierer Stumm-Orgeln, die Orgel in St. Gangolf 1829 und die der Garnisonskirche und evangelischen Pfarrkirche (Jesuitenkirche) um 1830. Von all diesen Instrumenten hat allein die Stumm-Orgel in der Welschnonnenkirche die Zeiten überdauert. Sie und die vier Jahre ältere Orgel in St. Paulin sind die einzigen Orgeln in der Trierer Altstadt, die aus dem 18. Jahrhundert stammen.
Gebaut hat sie die berühmte Orgelmanufaktur Stumm in Rhaunen-Sulzbach, eine Firma, deren qualitätvolles Arbeiten sich über 200 Jahre erstreckte, von 1720 bis 1920. Der im Trierer Bistumsarchiv erhaltene Orgelvertrag, am 10. Juli 1754 zwischen Oberin M. Charlotte Jacquemin und den Brüdern Joh. Heinrich und Joh. Philipp Stumm in französischer Sprache abgefasst, verpflichtet die Orgelbauer, Söhne des Werkstattgründers Joh. Michael Stumm, zur Lieferung eines detailliert beschriebenen Positivs von 11 klingenden Registern und angehängtem Pedal für die Trierer Welschnonnenkirche. Der Manualumfang betrug C-c‘‘‘ ohne das Cis, das Pedal hatte keine eigenen Register und reichte von C-d°, ebenfalls ohne Cis.
Nach mehreren schwerwiegenden Umbauten im 19. und 20. Jahrhundert wurde die Orgel 2006 auf ihren ursprünglichen Zustand zurück-restauriert.